| | | | 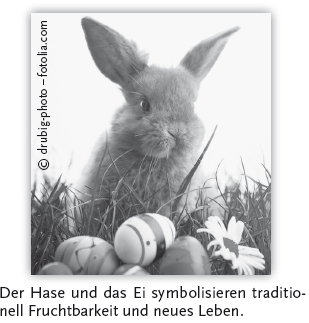 |
Zu Ostern spielt das Ei eine große Rolle, da es die Kirche einst streng verbot, in der Fastenzeit Eier oder Eierspeisen zu verzehren. Doch gerade zu dieser Jahreszeit legten die Hühner besonders fleißig, sodass große Mengen an Eiern zusammenkamen. Sie wurden aufbewahrt, gekocht oder in Salzwasser eingelegt. Bis Ostern waren es dann so viele, dass sie gern und
großzügig verschenkt wurden.
Außerdem gab es ein altdeutsches Eiergesetz, in dem verankert war, dass der Grund- und Bodenzins in Form von Eiern erbracht werden sollte. Stichtag für diese Naturalienzahlung war Ostern.
Die Sache mit dem Hasen
Auch der Hase gilt als Fruchtbarkeitssymbol und hat sich seit dem 16. Jahrhundert als Eierbote etabliert. In den Jahrhunderten davor hatte er noch Konkurrenten: In Holstein und Sachsen war es der Hahn, im Elsass der Storch, in Hessen der Fuchs und in der Schweiz der Kuckuck. Die Süßwarenindustrie hat der Hase angeblich durch ein Missgeschick erobert: Ein erfinderischer Bäcker soll Osterlämmer als Osterhasen angepriesen haben.
Hase, Henne oder Ei?
Wie man allerdings auf die Idee kam, dass der Hase zu Ostern Eier legt, ist bis heute ungeklärt. Der deutsche Dichter Eduard Mörike (1804 bis 1875) hat sich darauf seinen eigenen Reim gemacht:
Die Sophisten und die Pfaffen
stritten sich mit viel Geschrei:
Was hat Gott zuerst erschaffen?
Wohl die Henne? Wohl das Ei?
Wäre das so schwer zu lösen?
Erstlich ward ein Ei erdacht:
Doch weil noch kein Huhn gewesen,
Schatz, so hat der Hase es gebracht. | | | | |
|
|